Sammlung digital
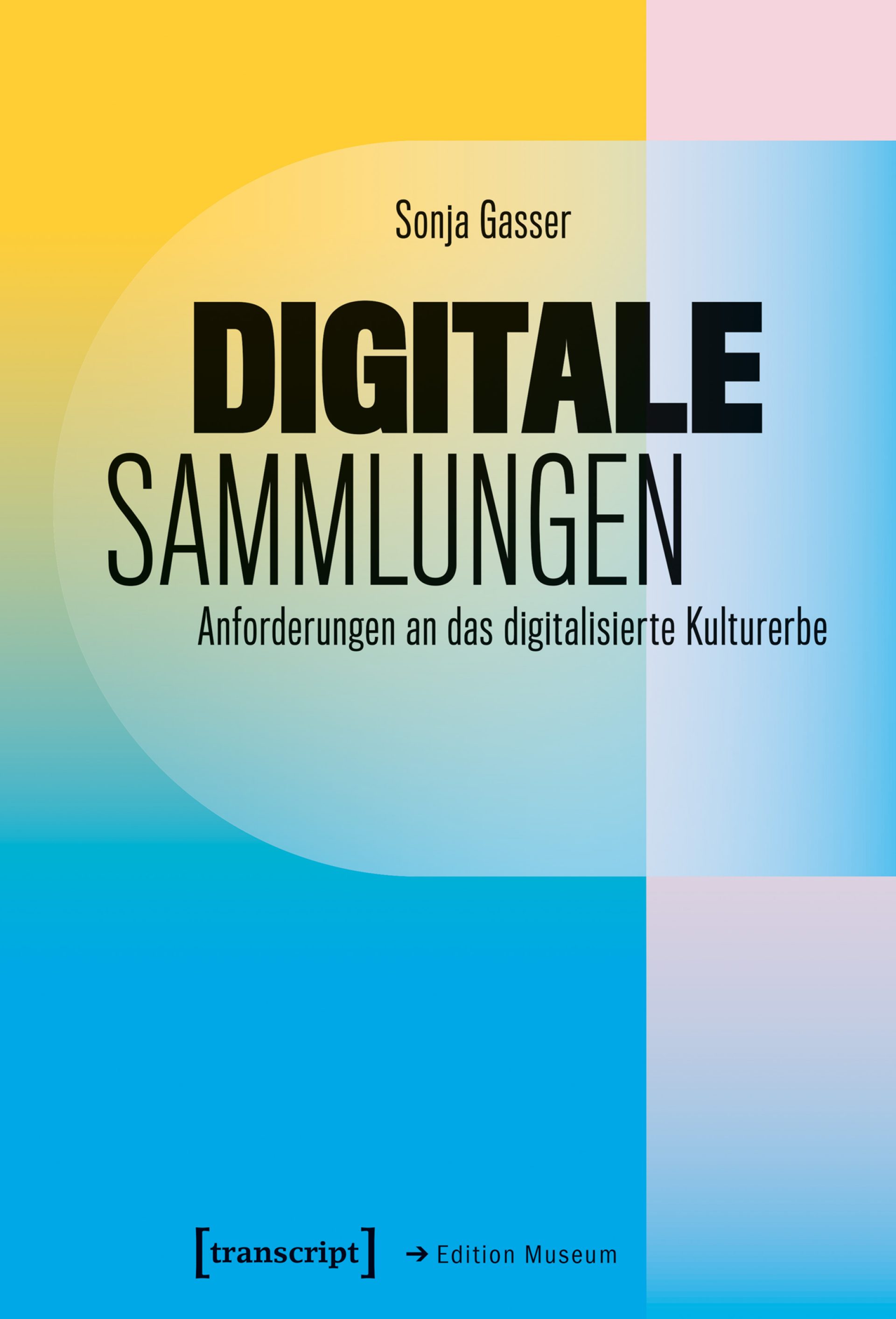
Kulturerbe vernetzt
Kulturerbe, davon sind die Mitarbeiter:innen der SKKG überzeugt, kann zentrale Werte wie Toleranz und Respekt vor kulturellen Unterschieden vermitteln – sofern es für Menschen zugänglich ist. Mit dem Projekt «Sammlung digital» will die Stiftung ihre Sammlung in den nächsten Jahren daher nicht nur einfach ins Netz stellen, sondern auch Daten klug vernetzen.

Sonja Gasser. © Ariel Leuenberger
In der Sammlung der SKKG befinden sich über 100’000 Kunstwerke und historische Objekte. Seit dem grossen Reinigungs- und Registrierungsprojekt sind sie alle in der Datenbank MuseumPlus erfasst, für die Öffentlichkeit jedoch noch nicht verfügbar. Die meisten von ihnen warten gereinigt und sicher verstaut in verschiedenen Depots auf ihren grossen Umzug ins Sammlungshaus im CAMPO. Einige werden aktuell auch in Museen in der ganzen Schweiz in Ausstellungen gezeigt. Neben dem Ausstellen ist es bei Museen gängige Praxis, der Öffentlichkeit digital Zugriff auf ihre Sammlungen zu geben.
Die SKKG wird zwar auch im CAMPO kein eigenes Museum bauen, aber die Zugänglichkeit zur Sammlung – physisch und online – ist ein wichtiges Ziel der Stiftung. Die SKKG ergreift die Chance, bei der Umsetzung des Projekts «Sammlung digital» über eher eng definierte Grenzen einer digitalen Repräsentation von Sammlungen hinauszugehen. Stattdessen soll eine stetig erweiterbare Wissensplattform entstehen.
1 + 2 = 100
In der Interaktion mit Menschen, in der Gegenüberstellung mit anderen Objekten, Archivdokumenten und weiteren Ressourcen sowie mithilfe digitaler Werkzeuge lässt sich aus Kulturerbe neues Wissen entwickeln. Mit dem Projekt «Sammlung digital» schafft die Projektleiterin Sonja Gasser eine Plattform, die als «Data Hub» Informationen zu den Kunstwerken und Objekten aus verschiedenen Ressourcen bündelt. Dafür arbeitet sie eng zusammen mit Kolleg:innen aus den Bereichen Sammlung, Provenienzforschung, Kommunikation, Restaurierung, Leihverkehr und den externen Expert:innen der Swiss Art Research Infrastructure (SARI) der Universität Zürich und den Zürcher Informations-Architekten Astrom / Zimmer & Tereszkiewicz.
Ein Hub – zu Deutsch eine Drehscheibe – bedeutet, dass auf dieser Plattform Informationen nicht nur bereitgestellt werden, sondern im Laufe der Zeit durch die Aktivitäten der Nutzer:innen erweitert, angereichert und neue Verbindungen hergestellt werden. So wie CAMPO ein physischer Ort der Begegnung und eine Denkwerkstatt wird, so kann man sich die «Sammlung digital» als einen virtuellen Möglichkeitsraum vorstellen, der als Zusammenarbeits-, Forschungs- und Vermittlungsplattform ganz unterschiedlichen Interessensgruppen dienen kann.
Du + Ich = Wir
Damit die Plattform «Sammlung digital» auch wirklich als Hub fruchtbar wird, müssen die Interessen und Bedürfnisse der Nutzer:innen an die Bereitstellung von Informationen mitbedacht werden. Im Auftrag der SKKG hat Sonja Gasser, damals noch als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin bei den Digital Humanities an der Universität Bern tätig, eine Umfrage durchgeführt, um die Wünsche von verschiedenen Nutzer:innengruppen an einen digitalen Sammlungszugang zu verstehen. Die anonyme Online-Umfrage wurde im Februar und März 2022 durchgeführt und 190-mal ausgefüllt.
Beteiligt hatten sich vor allem Personen, die professionell im Museumsbereich tätig sind, in der Kunstgeschichte und weiteren Geisteswissenschaften sowie im technologischen Bereich der Digital Humanities, Informatik und GLAM (das Akronym steht für Galleries, Libraries, Archives, Museums). Die Umfrage wurde bewusst so konzipiert, dass die Resultate auch für andere Museen/GLAM-Institutionen von Interesse sein können für ihre eigene Arbeit. Der SKKG ist der Austausch mit der Fachcommunity ein wichtiges Anliegen, weshalb die Ergebnisse der Umfrage online verfügbar sind.
Die Ergebnisse und Analysen der Umfrage hat Sonja Gasser in der Publikation «Digitale Sammlungen. Anforderungen an das digitalisierte Kulturerbe» zusammengefasst. Sie sollen Museen und anderen Kulturinstitutionen Orientierung und Inspiration bieten – beispielsweise bei der Entwicklung oder Erweiterung eines digitalen Angebots und der Abstimmung digitaler Sammlungen auf die Bedürfnisse von Nutzer:innen. Das Buch, herausgegeben von der SKKG und soeben erschienen im transcript Verlag, kann man bestellen oder als Open-Access-Publikation (PDF) herunterladen.
Sonjas Buch herunterladen
Sonja Gasser im Workshop mit Severin Rüegg, Leiter Sammlung, und Lukas Zimmer von Astrom / Zimmer & Tereszkiewicz. © Ariel Leuenberger
Vernetzt im Netz
Für die SKKG ist die Digitalisierung von strategischer Bedeutung: Nebst der Sichtbarkeit der Objekte in Ausstellungen im In- und Ausland ermöglicht eine digitale Plattform längerfristig die Zugänglichkeit der Sammlung für Kurator:innen, Wissenschaftler:innen und die interessierte Öffentlichkeit. Die Stiftung ist zudem am gemeinsamen Weiterkommen in Fragestellungen interessiert, die vergleichbare Institutionen beschäftigen. Aus diesem Grund ist es wichtig, Erfahrungen in der digitalen Repräsentation von Sammlungen zu teilen und in Kooperationen und Partnerschaften mit anderen zusammen an Projekten zu arbeiten.
Damit der Objektbestand der SKKG breit im Netz auffindbar ist, wird dieser in Zukunft auch über andere Plattformen wie beispielsweise Europeana, Wikimedia Commons oder Museum digital bereitgestellt werden. In grossen Suchportalen wie der Europeana werden die Objekte der SKKG im Kontext von Objekten anderer wichtiger Museen und Sammlungsinstitutionen sichtbar. Über Wikimedia Commons können Abbildungen von Objekten durch Wikipedianer:innen aus der ganzen Welt leicht in Wikipedia-Artikel eingebunden werden.
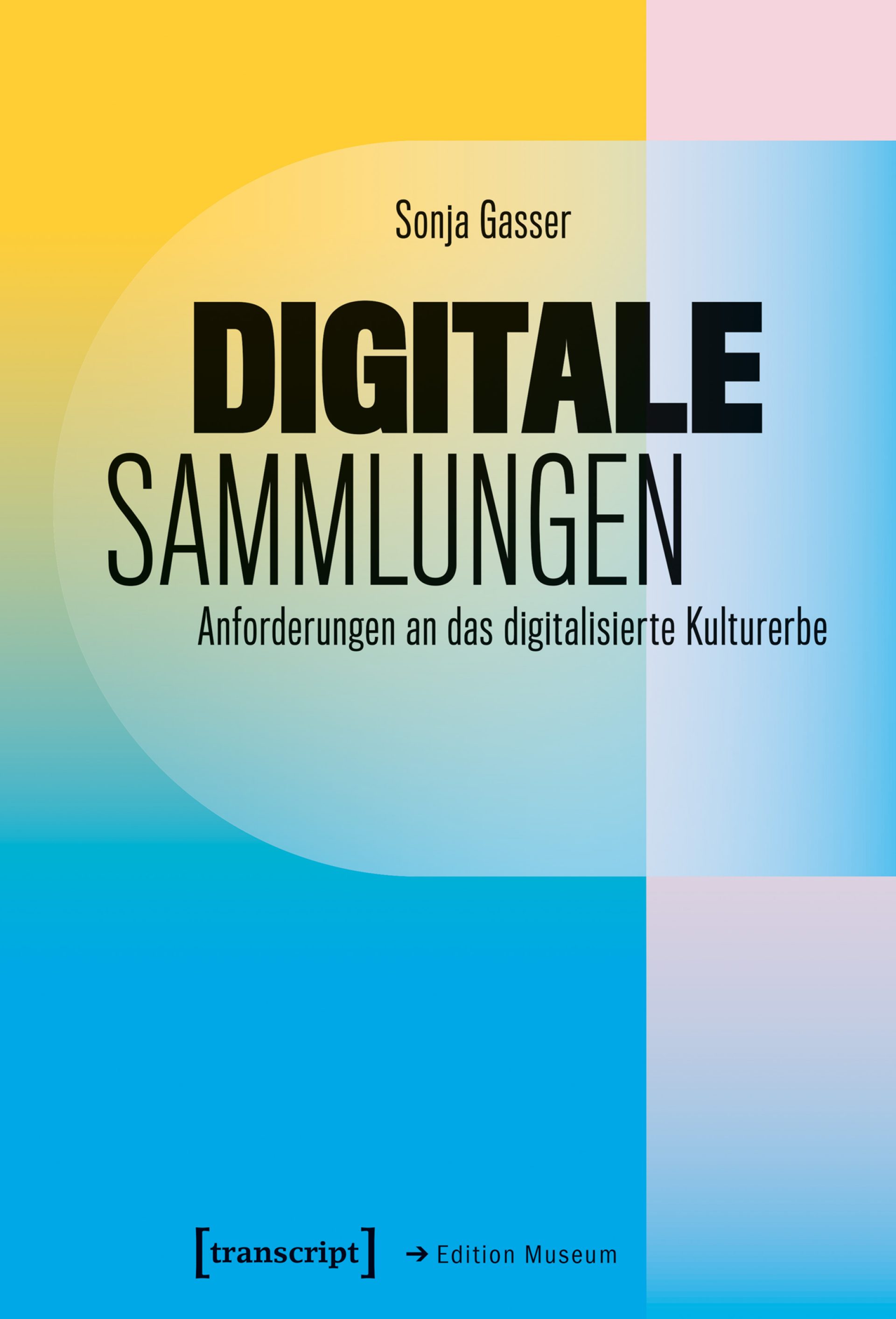
Der Weg ist das Ziel
«Sammlung digital» ist der Arbeitstitel des Projekts. Wie die Plattform genannt werden wird, wenn sie im Laufe des Jahres 2024 in einer ersten Form online gehen und der breiten (Fach-)Öffentlichkeit das gezielte Suchen nach Kunstwerken und Objekten ermöglichen wird, ist zurzeit noch unklar. Klar ist hingegen, dass die Plattform laufend weiterwachsen und neue Inhalte, Funktionalitäten und Zugänge bieten wird. Die Grunddaten, die bereits in der Datenbank MuseumPlus erfasst sind, werden in den nächsten vier Jahren angereichert mit Informationen aus zusätzlichen Quellen. Hierbei kann es sich um weitere Bilder, 3D-Modelle, Archivpläne, Multimedia-Inhalte usw. handeln.
Mit diesen Daten wird dann auch experimentiert: Welche Zusammenhänge kann man herstellen, welche Kontexte besser verstehen? Wie können Informationen zu Objekten dargestellt werden? Ziel ist es, eine im Internet öffentlich zugängliche Plattform zu schaffen, die die Resultate dieser Arbeit greifbar macht – und mit der jede:r Nutzer:in individuell weiterarbeiten kann. Bis diese Plattform online ist, braucht es noch viel Anstrengung, Kreativität und wohl auch ein paar (Freuden-)Tränen.